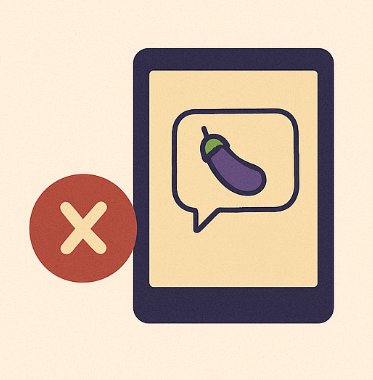Hier gehts zum PDF: Dickpics werden strafbar
Dickpics werden strafbar
Aber wie genau kann man sich eigentlich gegen Online-Hass wehren?
Stalking, Hate Speech, Dickpics – viele Menschen machen online auch negative Erfahrungen. Aktuelle repräsentative Studien dazu, wie häufig solche Fälle in Österreich vorkommen, gibt es nicht; wenn man Medienberichten und privaten Anekdoten Glauben schenkt, sind die Zahlen dazu jedoch erstaunlich hoch. Auch Medienschaffende sind immer wieder Anfeindungen ausgesetzt.
Der Umgang mit diesen Erfahrungen ist mitunter schwierig und kräftezehrend, rechtliche Schritte sind aufwändig, langwierig und zum Teil schlicht nicht möglich.
Die gute Nachricht: Da tut sich gerade was!
Gesetzesänderung
Wer beispielsweise ungefragt Dickpics verschickt, kann in Zukunft dafür bestraft werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bilder über soziale Medien, per Mail oder in Dating-Apps verbreitet werden – es handelt sich auf jeden Fall um eine Form von sexueller Belästigung.
Geahndet werden kann das Ganze mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen.
Grundlage dafür ist eine Gesetzesänderung, die am 1. September 2025 in Kraft tritt.
„Ebenso ist zu bestrafen, wer eine andere Person belästigt, indem er ihr im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems eine Bildaufnahme von Genitalien unaufgefordert und absichtlich übermittelt.“
– § 218 Abs. 1b StGB.
Wie aber müssen Betroffene konkret vorgehen, wenn sie von digitaler Gewalt betroffen sind und dies zur Anzeige bringen wollen? Und was können Medienhäuser gegen sexuelle Belästigung und andere Formen von digitaler Gewalt tun?
Was du tun kannst
✔️ Dokumentiere den Vorfall, indem du Screenshots anfertigst und lokal abspeicherst. Schreib am besten auch die genauen Daten von Absender:in und Empfänger:in, konkrete Angaben zur Plattform sowie Datum und Uhrzeit auf.
✔️ Such dir Unterstützung und lass dich beraten. Mögliche Anlaufstellen sind zum Beispiel der Opfernotruf und die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Beide sind auch per E-Mail und telefonisch erreichbar. Es gibt auch Angebote speziell für Frauen und für Männer.
✔️ Erstatte Anzeige bei der Polizei. Das kannst du direkt bei einer Polizeidienststelle oder sogar per E-Mail machen. Die Polizei empfiehlt jedoch die persönliche Variante, weil sie dann direkt Nachfragen stellen und tätig werden kann. Je besser du den Vorfall dokumentiert hast, desto besser stehen deine Chancen auf Erfolg.
❌ Schicke die Inhalte auf keinen Fall weiter, auch wenn du anderen „nur“ zeigen willst, was dir passiert ist. Im schlimmsten Fall machst du dich damit selbst strafbar.
Was Medienhäuser tun können
Viele Befragten der ICJF-Studie fühlten sich während ihrer Gewalt-Erfahrung verzweifelt und allein gelassen. Medienhäuser sind jedoch nicht nur Content Producers, sie sind auch Schutzräume – oder sollten es zumindest sein. Wenn du in deinem Team oder Haus Veränderungsbedarf siehst: Sprich es an! Teil der Lösung sein heißt auch, Strukturen zu hinterfragen.
„Many of the journalists interviewed for this study expressed exasperation and a sense of abandonment by their employers when they were in the midst of an online violence storm, even when there were credible threats of offline violence associated with these attacks.“ – a ICJF 2022, S.131
Damit das einfacher gelingt, machen wir dir in Anlehnung an das International Center for Journalists (ICJF) konkrete Vorschläge, wie Medienunternehmen digitaler Gewalt erfolgreich begegnen können.
Schritt 1: Die Realität anerkennen
💡Medienunternehmen sind online ebenso für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter:innen verantwortlich wie offline. Es gilt die Fürsorgepflicht.
Schritt 2: Die Prävention stärken
💡 Klare Richtlinien aufstellen
Wer ist zuständig, wenn digitale Gewalt passiert? Was zählt überhaupt dazu? Und was passiert dann? Diese Fragen brauchen Antworten – schriftlich, verständlich, für alle zugänglich.
💡 Anlaufstellen schaffen
Betroffene brauchen klare Wege zur Hilfe, ohne Angst vor Nachteilen. Wer diese Wege betreut, muss geschult und empathisch sein.
💡 Medienkompetenz stärken
Nicht jede Redaktion muss zur Digital-Unit werden, aber Grundlagen zu Datenschutz, digitaler Selbstverteidigung und Deeskalation gehören heute in jedes Redaktionstraining.
💡 Risiken mitdenken
Ihr plant einen investigativen Beitrag, ein kontroverses Interview oder einen Social-Media-Stunt? Dann gehört eine Risikoabschätzung dazu, und zwar nicht nur technisch, sondern auch psychisch und körperlich.
💡 Kommentarspalten managen
Community-Management braucht Regeln – und Leute, die sie durchsetzen können. Wenn’s zu viel wird: Kommentarfunktion gezielt drosseln oder abschalten. Kein Grund zur Panik, sondern aktiver Schutz.
💡 Psychologische Hilfe anbieten
Manche Angriffe hinterlassen Spuren. Supervision, Einzelgespräche, Coaching: Was auch immer hilft, sollte niedrigschwellig verfügbar sein.
Schritt 3: Richtig reagieren
💡 Sicherheit schaffen
Online-Hass kann in reale Gefahr umschlagen. Wenn’s brenzlig wird: Unterbringung an einem sicheren Ort prüfen.
💡 Rückendeckung organisieren
Private Accounts deaktivieren, juristische Beratung einholen, konstantes Monitoring. Oft brauchen Betroffene aktive Hilfe im Hintergrund.
💡 Öffentliche Solidarität zeigen
Kein „Wir halten uns da raus“. Wenn ein Angriff passiert, heißt’s Haltung zeigen. Eine klare Stellungnahme von oben kann mehr Schutz bedeuten als jedes Sicherheitstool.
💡 Dokumentation nicht vergessen
Screenshots, Links, Uhrzeiten – alles sichern! Nicht nur fürs Verfahren, sondern auch, um intern zu lernen: Was hat funktioniert, was nicht?
💡 Juristische Unterstützung anbieten
Ob Anzeige oder Unterlassung: Rechtsschutz darf nicht an der Kostenfrage scheitern. Klare Vereinbarungen helfen.
💡 Wenn nötig Anzeige erstatten
Das Unternehmen kann und soll federführend agieren, wenn es die Lage erfordert, jedoch immer in Abstimmung mit der betroffenen Person.
Q&A
Wir haben mit einer Juristin über das Thema gesprochen und ihr einige Fachfragen gestellt. Hier sind ihre Antworten.
Achtung: Es handelt sich hier um eine allgemeine Einschätzung und um keine verbindliche rechtliche Auskunft!
Welche Straftatbestände können im Zusammenhang mit digitaler Gewalt greifen?
Hass im Netz kann sich auf vielfältige Weise darstellen. Hasspostings im Internet können auch verschiedene Straftatbestände erfüllen. In Betracht kommen dabei neben Straftatbeständen des Verbotsgesetzes 1947 insbesondere folgende Delikte des österreichischen Strafgesetzbuches (StGB):
- Nötigung (§ 105 StGB)
- Gefährliche Drohung (§ 107 StGB)
- Beharrliche Verfolgung (§ 107a StGB)
- Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems (§ 107c StGB)
- Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen (§ 282 StGB)
- Verhetzung (§ 283 StGB)
- Verleumdung (§ 297 StGB)
- Kreditschädigung (§ 152 StGB)
- Üble Nachrede (§ 111 StGB)
- Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung (§ 113 StGB)
- Beleidigung (§ 115 StGB)
Gibt es hier einen Unterschied zwischen Privatpersonen und Unternehmen?
Von „Hass im Netz“ wird nur der höchstpersönliche Lebensbereich einer Person geschützt, über den nur natürliche Personen verfügen. Juristische Personen könnten sich etwa über § 1330 ABGB (Kreditschädigung) Abhilfe schaffen.
Kommt dem Arbeitgeber eine Verpflichtung zu?
Neben der von Hass im Netz betroffenen Person selbst kann auch die/der Arbeit- oder Dienstgeber:in gegen die Persönlichkeitsrechtsverletzung (das Hassposting) gerichtlich vorgehen.
Wenn Hasspostings gegen Mitarbeiter:innen in Zusammenhang mit deren Arbeit gerichtet sind, steht unter bestimmten Voraussetzungen auch der/dem Arbeit- oder Dienstgeber:in die Klage offen. Das ist der Fall, wenn das Hassposting geeignet ist, entweder
- die Möglichkeiten der Arbeit- oder Dienstgeber:in, die/den Mitarbeiter:in einzusetzen, nicht unerheblich zu beeinträchtigen, oder
- das Ansehen der Arbeit- oder Dienstgeber:in erheblich zu schädigen.
Wichtig ist: Es gibt dazu keine Verpflichtung der Arbeit- oder Dienstgeberin. Wenn die Arbeit- oder Dienstgeber:in sich aber dazu entscheidet, dann bedarf es auch keiner Einwilligung des/der Mitarbeiter:in.
Was kann ein Unternehmen tun, wenn es immer wieder mit Hasspostings und bösartigen Kommentaren konfrontiert ist?
Wie eingangs ausgeführt, kann sich „Hass im Netz“ ganz unterschiedlich gestalten und hat viele Erscheinungsformen, die sich auch stetig weiterentwickeln. Dementsprechend gibt es auch keine rechtliche einheitliche Definition oder Abgrenzung. Hasspostings im Internet können somit auch verschiedene zivilrechtliche, aber auch strafrechtliche Straftatbestände erfüllen.
Das Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz (HiNBG) BGBl I 2020/148 enthält zivilrechtliche, medienrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen zur leichteren Entfernung so genannter Hasspostings aus den Foren sozialer Netzwerke.
Mit dem Gesetzespaket „Hass im Netz“ hat der österreichische Gesetzgeber ein zivilgerichtliches Sonderverfahren vorgesehen, das auf die Eigenheiten von Hasspostings Rücksicht nehmen soll. Aufgrund der Verbreitung im Internet verlangt ein Vorgehen gegen Hasspostings nämlich insbesondere ein schnelles Vorgehen und rasche Abhilfe: Dazu wurde ein „Eilverfahren“ für massive Fälle von Persönlichkeitsrechtsverletzungen zur Verfügung gestellt.
Dabei handelt es sich um ein Gerichtsverfahren, mit dem Betroffene rasch und kostengünstig bestimmte rechtsverletzende Inhalte (etwa Texte, Postings, Bilder) aus dem Internet beseitigen können. Dazu kommt es dann, wenn durch die betreffenden Inhalte die Persönlichkeitsrechte erheblich (nämlich in einer die Menschenwürde beeinträchtigenden Weise) verletzt werden.
Weitere Infos und Hilfe dazu gibt’s hier.
Nach dem Mediengesetz (MedienG) kann das Opfer von Hass im Netz unabhängig oder zusätzlich zu einem Straf- oder Zivilverfahren verschiedene Ansprüche geltend machen. Diese können sich aus Veröffentlichungen in Medien ergeben. Dazu zählen etwa Zeitungen, Bücher und Zeitschriften, aber auch Online-Medien wie Websites, Blogs, soziale Netzwerke, Video-Kanäle oder Podcasts.
Für Opfer von Hass im Netz sind dabei insbesondere das selbständige Entschädigungsverfahren (§ 8a MedienG) und das Verfahren zur Einziehung und/oder Urteilsveröffentlichung (§§ 33, 34 MedienG) von Bedeutung.
Wie lange dauert es durchschnittlich, bis ein Verfahren abgeschlossen ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass der/die Täter:in zur Verantwortung gezogen wird?
Verfahrensdauer und Erfolgschancen richten sich immer nach dem Verfahren. Das (zivilgerichtliche) Eilverfahren soll bewusst schnelle Abhilfe schaffen und wurde gerade aufgrund der potenziell längeren Verfahrensdauer von Gerichtsverfahren vorgesehen. Eine Statistik zu den abgeführten Verfahren wurde – soweit ersichtlich – bislang nicht veröffentlicht. Höchstgerichtliche (und damit veröffentlichte) Entscheidung sind zuteil teilweise ergangen.
Infos & Quellen
Kontext
Hass im Netz ist nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein medienkompetenzbezogenes Problem. Denn wer Medien macht, muss digitale Räume verstehen. Und das schließt auch ihre Risiken mit ein. Medienkompetenz bedeutet in diesem Kontext also: Gefahren erkennen, sicher handeln und andere darin schulen können. Sie ist die Grundlage, um digitale Gewalt nicht nur zu überstehen, sondern ihr aktiv etwas entgegenzusetzen.
Quellen
Bundesministerium Justiz: https://www.bmj.gv.at/themen/Fokusthemen/gewalt-im-netz/Zivilrechtlicher-Schutz/Das-Mandatsverfahren.html.
Gleichbehandlungsanwaltschaft: https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at/.
Kontrast.at: https://kontrast.at/dickpic-paragraf-oesterreich/.
Menschen machen Medien; Annika Schubert (2023): https://mmm.verdi.de/beruf/digitale-gewalt-gegen-journalistinnen-93193/.
Ombudsstelle: https://www.ombudsstelle.at/hass-im-netz/wie-mache-ich-eine-strafanzeige/.
Stadt Wien: Datenlage zu Cyber-Gewalt: https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/kampagnen/cyber-gewalt/datenlage.html#:~:text=Neben%20der%20EU%20%2DStudie%20gaben,BIM%2C%20Wei%C3%9Fer%20Ring%202018.
Strafgesetzbuch, § 218: https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&Paragraf=218.
Erläuterungen Strafgesetzbuch, § 218 Abs. 1b: https://www.bmj.gv.at/dam/jcr:b4717513-c9bd-4da3-afa5-b30c89ba84d2/Erl%C3%A4uterungen%20StGB_%C3%84nderung.pdf.
Studien
Habringer, Magdalena; Hoyer-Neuhold, Andrea & Messner, Sandra (2021). (K)ein Raum. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen. Forschungsbericht. https://digital.obvsg.at/obvfcwacc/download/pdf/8718964
Forschungszentrum Menschenrechte & Weisser Ring Opferschutzhilfe (2018). esc. Gewalt im Netz gegen Frauen & Mädchen in Österreich.
- Studie: https://www.weisser-ring.at/wp-content/uploads/2019/10/Studie_Bestandsaufnahme_Gewalt_im_Netz_gegen_Frauen_und_M%C3%A4dchen_in_%C3%96sterreich.pdf.
- Broschüre: https://gmr.lbg.ac.at/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/broschuere-gewalt-im-netz_2018.pdf.
ICJF (2022). The Chilling: A Global Study On Online Violence Against Women Journalists. Hrsg. v. Julie Posetti und Nabeelah Shabbir. https://www.icfj.org/our-work/chilling-global-study-online-violence-against-women-journalists.
Mediendienst Integration & IKG. Papendick, Michael; Rees, Yann; Wäschle, Franziska & Zick, Andreas (2020). Hass und Angriffe auf Medienschaffende. Eine Studie zur Wahrnehmung von und Erfahrungen mit Angriffen auf Journalist*innen. https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf.
RSF Reporter ohne Grenzen (2021). Wie Sexismus Journalistinnen bedroht. https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/RSF_Frauentag_2021_Sexismus_Journalismus.pdf.
Saferinternet (2025). Sexuelle Belästigung Online. Durchgeführt vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung. https://www.saferinternet.at/news-detail/neue-studie-jugendliche-von-sexueller-belaestigung-im-internet-betroffen.